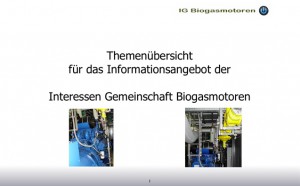Für den wirtschaftlichen Erfolg der Investitionsprojekte in ein Biogas-BHKW mit optimaler Flexibilisierung und Wärmeauskopplung sind mehrere Fragen an das Flexibilisierungskonzeptes zu stellen. Im Einzelfall ergibt dies sehr unterschiedliche Antworten – abhängig von den lokalen Randbedingungen. Die ertragsoptimale Verwertung des flexibel erzeugten Stromes und der Wärme lassen erwarten, dass Betreiber die Vermarktung in der kälteren Hälfte eines Jahres anstreben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wetterkapriolen und des tendenziell starken Klimawandels sind dann Gasspeicher und Wärmepufferspeicher so auszulegen, dass ein Biogas-BHKW mit optimaler Flexibilisierung und Wärmeauskopplung mit guter Wirtschaftlichkeit betrieben werden kann.
1. Kriterien eines Flexibilisierungskonzeptes
Ein Biogas-BHKW mit optimaler Flexibilisierung und Wärmeauskopplung muss zwei Märkte bedienen: den Strom- und den Wärmemarkt. Wobei letzterer noch unterschieden werden muss in Heizungswärme und gewerblich genutzter Prozesswärme. Gerade der letztgenannte Bereich bietet durchaus noch beträchtliche Wachstumsperspektiven, da Hersteller energieintensiv gefertigter Produkte ein großes Interesse an grüner Prozesswärme haben. Diese Hersteller benötigen einen niedrigen “Carbon Footprint” ihrer Produkte für ihr Großhandels-Listing. Dafür lässt sich das Biogas-BHKW mit auskoppelbarer Prozesswärme von mehr als 200°C einsetzen. Eine räumlich Nähe des Biogas-BHKWs mit Wärmepufferspeicher zum Fertigungsbetrieb ist vorteilhaft, aber im ländlichen Raum nicht immer gegeben, hier können Alternativen im Bereich transportabler Wärme, wie im Punkt 5 angedeutet, weiterhelfen.
Die Jahresbetriebsstunden sind vor dem Hintergrund des Zubaues an Wind und Solarstrom-Kapazitäten sowie der verbleibenden Betriebsstunden mit Börsenstromerlösen oberhalb von 2 Cent/kWh konservativ zu schätzen. Dies reduziert zwar die verfügbaren Betriebsstunden pro Jahr, auf der anderen Seite sorgt eine starke Überbauung dafür, dass Effizienzgewinne eines großen Megawatt-Aggregates und Mehrerlöse der Stromvermarktung den notwendigen Ertrag herbeiführt. Dazu gehörten auch Instandhaltungskonzepte und eine Betriebsdatenanalyse, die BHKW-Betriebskosten gering halten und ungeplante Anlagenstillstände vermeiden.
2. Was bedeutet Biogas-BHKW mit optimaler Flexibilisierung?
Vor wenigen Jahren war fünffache Überbauung das Maximum. Heute sind wir bei maximal 10-facher Überbauung (Biomethan-Peaker mit 800 Betriebsstunden pro Jahr). Das darf auch alles so sein, aber angepasst an die lokalen, spezifischen Anforderungen eines Betriebes. Und das wird dann genau durchgerechnet, ob am Ende des Tages auch ein profitabler Anlagenbetrieb möglich ist.
Je höher die Überbauung ist, desto geringer sind die täglichen Betriebsstunden. Desto größer sind auch die Stillstandszeiten des BHKWs. Die Biogasanlage produziert aber kontinuierlich – also bedarf es eines ausreichend großen Reingasspeichers. Eine Biogasaufbereitung zu “flexibilisieren” ist theoretisch möglich, praktisch aber nicht zu empfehlen, da dies mit hohen Kosten verbunden ist. Ein Reingasspeicher löst das Dilemma der Entkopplung von Biogas-Produktion und -Verbrauch auf und ermöglicht den passenden Volumenstrom für die unterschiedlich (großen) Flexaggregate, die nur wenige Stunden am Tage laufen. Die Bakterien produzieren auch nachts – das Flex-BHKW dagegen nicht (der Strompreis ist dann zumeist im Keller).
3. Kalt-Warm-Wechsel
Sechsfache Überbauung bedeutet 2 Schichten á 2 Stunden Volllast für das Biogas-Aggregat und 20 Stunden Stillstand pro Tag. Wenn der Gas- und Wärmepufferspeicher groß genug sind, wäre zu überlegen, ob man wegen der niedrigeren Strom-Preise am Wochenende das BHKW gar nicht betreibt, die Fütterung entsprechend sensibel anpasst und nur eine “Bereitschaft” bereithält, um im Notfall schnell handeln zu können (Gärstrecke und BHKWs). Natürlich wird der Wärmepufferspeicher von Freitagnachmittag bis Montagmorgen ca. 60 Stunden zu überbrücken haben, damit kein Wärmeabnehmer “kalt” wird. Auch Prozesswärme könnte je nach Lage des Schichtbetriebes von gewerblichen Wärmeabnehmern am Wochenende gefordert werden.
Wenn das Biogasaggregat starten soll, muss das aufbereitete Biogas gut temperiert vor Ort sein, also am Doppelblockventil der Gasregelstrecke anstehen. Die Aktivkohle wird schon ca. eine Stunde vorher vorgewärmt, denn kalte Aktiv-Kohle konvertiert nicht gut. Es gilt, im Flexbetrieb Schwefelwasserstoffeinträge mit hohem Schadenspotenzial zu verhindern. Bei automatisiertem Fahrplan, der den ertragsoptimalen Startzeitpunkt des BHKWs nach den relevanten Kriterien festlegt, kann auch die Vorwärmung passend angesteuert werden.
Ebenso wird der Biogasmotor in den Kühlkreisläufen vorgewärmt, damit der Motorkühlkreislauf und der Schmierölkreislauf für optimale Startbedingungen sorgen.
4. Full-Service-Verträge machen Wartungskosten planbar
Die Planbarkeit und Transparenz der Wartungskosten ist nur ein Aspekt eines mehrjährigen Full-Service-Wartungsvertrages, der mit Preisgleitklauseln nach Industriestandards auch das Maschinenbruchrisiko enthalten kann. Der Leistungsumfang und Geltungsbereich (für welchen Lieferumfang) ist genau zu spezifizieren, ebenso die gewünschte Leistungstiefe des Dienstleistungsumfanges. Wenn dies klar geregelt ist, können solche Verträge eine Vielzahl von Jahren zur Zufriedenheit und zum Nutzen beider Vertragsparteien funktionieren. Beide Seiten folgen dann einem gleichgerichteten Interesse, dass das BHKW ohne ungeplante Stillstände mit niedrigen Betriebskosten seinen Fahrplan erfüllt.
Vor Abschluss eines derartigen Full-Service-Vertrages steht eine ausführliche Vertragsverhandlung unter Einbindung aller erforderlichen Anlagen (zu wartende Anlagenteile, Ausgangsdaten der Preisgleitklausel, Reaktionszeiten etc.), damit sich eine Win-Win-Situation einstellt und die Risiken eines Flexbetriebes fair verteilt werden und niedrig bleiben, weil beide Seite die Betriebsdaten kontinuierlich erfassen und bewerten und somit zeitnah reagieren können.
5. Keine Angst vor Groß-Wärmepufferspeichern und neuen Techniken der Wärmespeicherung
Viele Betreiber, die flexibilisiert haben, bedauern, dass sie nicht in größere Wärmepufferspeicher investiert haben. Es ist ja nicht sinnvoll, dass ein BHKW laufen muss, nur weil der Wärmepufferspeicher sich innerhalb der geplanten Stillstandszeit des BHKWs entleert und Verbrauchern die Wärme fehlt.. Dann müssen neben einem Extra-Motorstart auch niedrige Strompreise in Kauf genommen werden. Wärmepufferspeicher rentieren sich erstaunlich schnell, deshalb sind diese ausreichend groß zu dimensionieren. Auch mehrtägige BHKW-Ausfälle verlieren dann ihren Schrecken und schonen das Nervenkostüm des Betreibers, da das Wärmenetz bei ausreichender Dimensionierung des Wärmepufferspeichers eine derartige “Durststrecke” überwinden kann. Außerdem schützt dies vor Wärmeersatzlieferung, die im Winter bei mangelnder Verfügbarkeit eines “Hotmobiles” teuer werden kann.
Gerade im ländlichen Raum tun sich Betreiber von Biogasanlagen mit Flexaggregaten zum Thema Wärmeauskopplung schwer. Ungünstige Streckenverläufe mit geringer Anschlussleistung für Heizwärme oder entfernt gelegene gewerbliche oder auch kommunale Wärmeabnehmer erschweren eine Wärmevermarktung. Dagegen können Wärmekonzepte der Kommunen und Kenntnis gewerblicher Produktionsbetriebe mit Prozess- und Heizwärmebedarf sowie der Heizwärmebedarf von kommunalen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen, Bäderbetriebe etc. den Brückenschlag zu grüner Wärme der Biogasanlage bedeuten.
Es gibt bereits stationäre Wärmepufferspeicher mit höherer Energiedichte und weniger Platzbedarf als wassergeführte Wärmepufferspeicher mit Druckhaltung: Sandspeicher sind hier eine erwägenswerte Alternative. Diese lassen sich mit heißen BHKW-Abgasen aufladen. Die Wärmeentnahme erfolgt über Durchleitung von Luft , die sich auf mehrere hundert Grad erhitzen kann. Über einen Luft-Wasser-Wärmetauscher wird dann Heiz- und / oder Prozesswärme gewonnen.
Auch der mobile Transport von Wärme der Biogasmotor-Abgase zu Wärmesenken über Hürden wie Autobahnnen, Gleise, Schifffartswege etc. ist mit Container-basierten Transporteinheiten von Wärme für entweder hohe Auskoppel-Wärmeleistung oder Auskoppel-Wärmemenge für Temperaturen von 200°C bis 1300°C gelöst.
Den nächsten Kurzworkshop “Biogas-BHKW mit optimaler Flexibilisierung und Wärmeauskopplung” am 27.11.2025 können Interessierte unter diesem Link buchen.